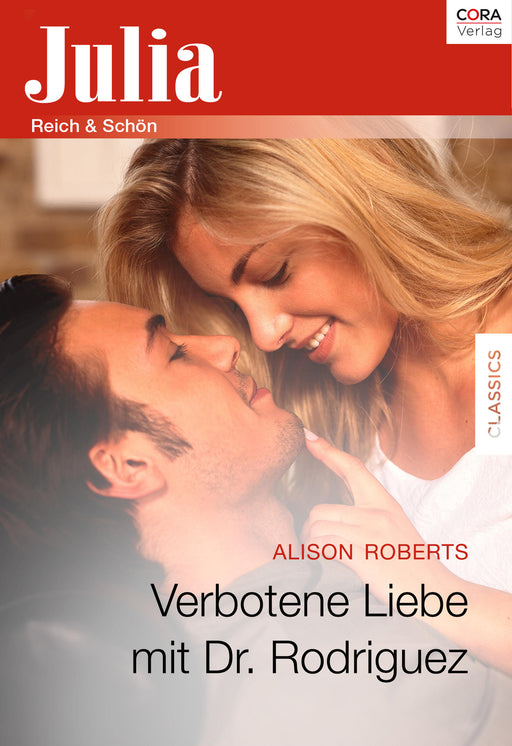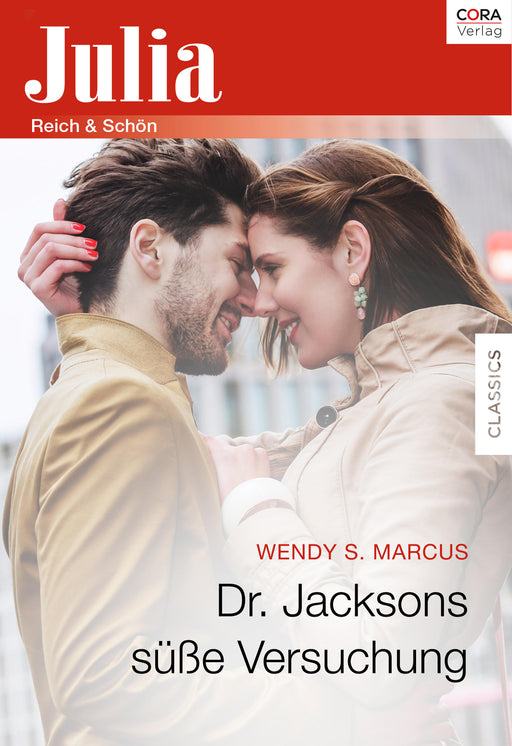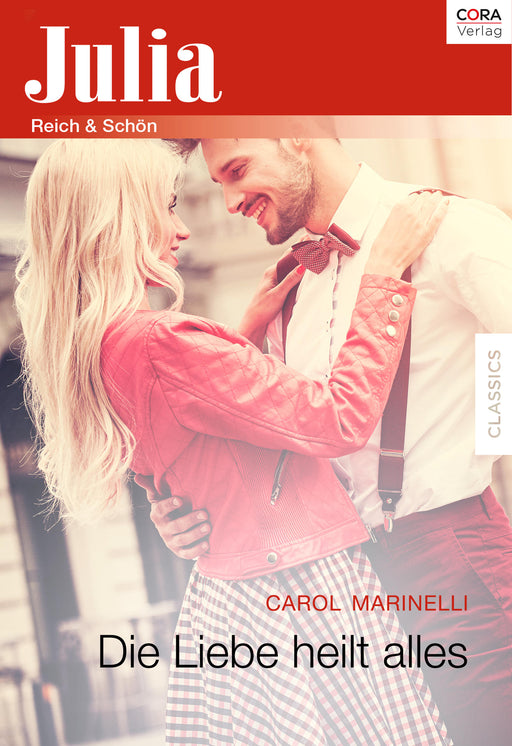Schenk mir dein Lächeln
Rückgabe möglich
Bis zu 14 Tage
Sicherheit
durch SSL-/TLS-Verschlüsselung
Dr. John Griffin ist Schwester Polly ein Rätsel: Für seine kleinen Patienten im Angel’s hat er immer ein Lächeln übrig, ihr jedoch zeigt er die kalte Schulter. War es ein Fehler, sich von ihm zum Dinner einladen und zu einer zärtlichen Liebesnacht verführen zu lassen?